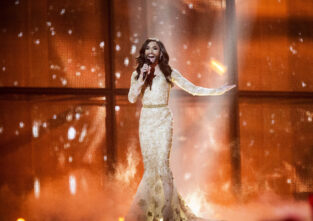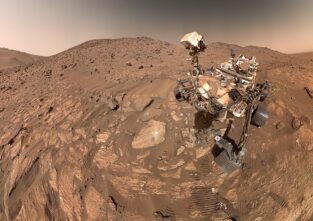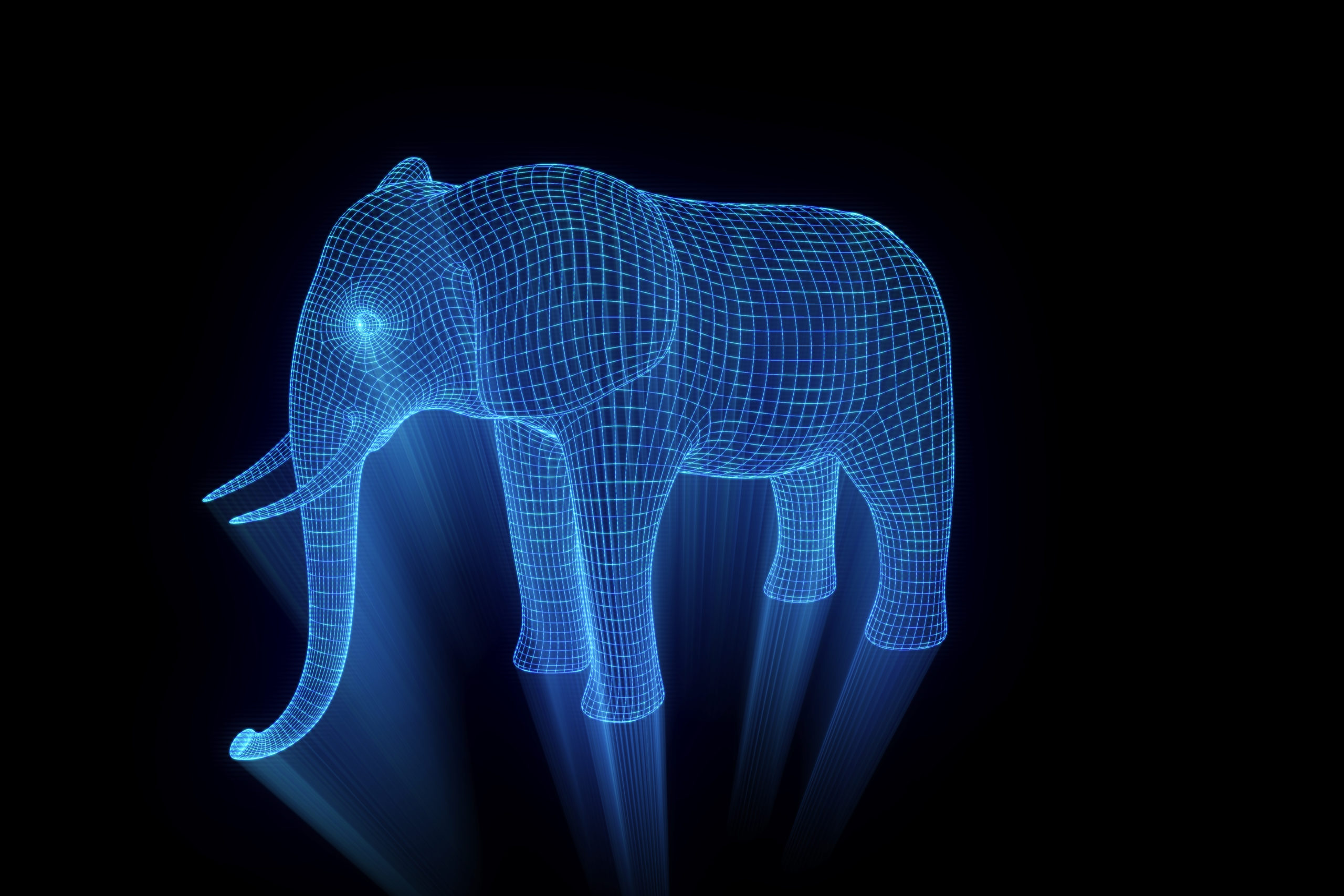In einer Woche beginnt in der australischen Stadt Melbourne (sprich: melbörn) eines der wichtigsten und größten Tennisturniere der Welt, das sogenannte „Australian Open“ (sprich: osträiliän oupen). Beim letzten Mal hat dieses Turnier Novak Đoković (sprich: nowak dschokowitsch) gewonnen. Ob er dieses Mal dabei sein und seinen Titel verteidigen kann, ist allerdings unsicher.
Novak Đoković (34) ist momentan der beste Tennisspieler der Welt. Er führt die Bestenliste im Tennis an. Trotzdem soll er nicht bei dem wichtigen Grand Slam-Turnier (sprich: gränd släm) dabei sein? Wie kann das sein? Dabei geht es nicht um den Sport, sondern um Corona.
Der Sportler aus Serbien (ein Land im Südosten von Europa) ist wahrscheinlich nicht gegen das Coronavirus geimpft. Der 34-Jährige wollte niemandem verraten, ob er geimpft ist oder nicht. Um nach Australien einzureisen, muss man aber geimpft sein. So sind eigentlich die Regeln. Die Menschen, die das Tennisturnier organisieren, wollten für Novak Đoković eine Ausnahme machen. Sie haben ihm erlaubt, auch ohne Beweis, dass er geimpft ist, beim Turnier zu spielen. Der Tennisprofi stieg also ins Flugzeug nach Australien. Als er dort jedoch am Flughafen landete, ließen ihn die Polizisten ohne Impfbestätigung nicht weiterreisen. Er wurde also zunächst in eine Wohnung gebracht, wo auch andere Menschen auf ihre Ausreise aus Australien warten.
Großer Wirbel
Viele Menschen haben sich aufgeregt, dass der Tennisspieler festgehalten wird. Andere wieder haben sich darüber aufgeregt, dass es für den Profisportler eine Ausnahme geben soll. In Australien sind die Regeln nämlich besonders streng. Viele Menschen müssen schon seit vielen Monaten mit diesen strengen Einschränkungen leben. Warum also sollte es für Novak Đoković eine Ausnahme geben, fragen sie sich.
Wie geht es jetzt weiter?
Wie genau es jetzt mit Novak Đoković weitergeht, ist unklar. In der Zwischenzeit hat er gesagt, dass er schon Covid-19 hatte und hat dafür auch eine Bestätigung vorgelegt. Am Montag sah es kurz so aus, als könnte der Tennisprofi in Australien bleiben. Er hat sogar schon wieder trainiert. Später hat der Tennisstar zugegeben, dass er bei der Einreise nach Australien falsche Angaben gemacht hat. Außerdem hat er, obwohl er an Covid-19 erkrankt war, ein Interview gegeben. Am Freitag hat ein Gericht erklärt, dass die Unterlagen, mit denen der Tennisspieler nach Australien eingereist sind, nicht ausreichen. Der Tennisprofi musste am Wochenende das Land verlassen.
Auf der Karte kannst du sehen, wo sich Melbourne genau befindet: