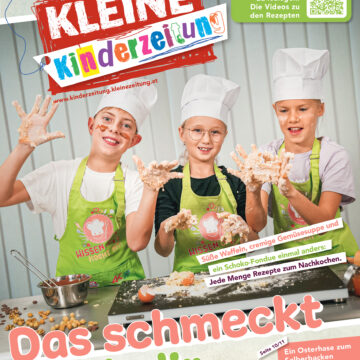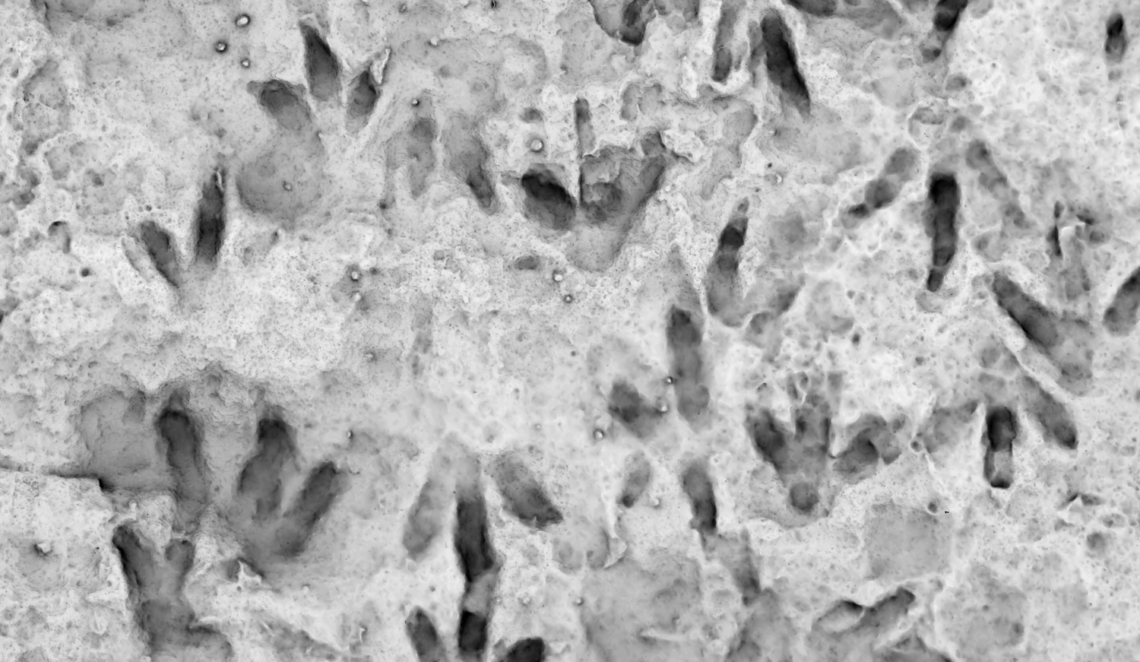In Österreich und Deutschland ging es am Montag, 26. Mai, recht hektisch zu. Die Aufregung war groß und die Stimmung angespannt. In Niederösterreich, Oberösterreich, Wien, dem Burgenland, Kärnten und der Steiermark haben nämlich etliche Schulen am Sonntagabend Bombendrohungen per E-Mail erhalten. Eine Bombendrohung ist, wenn jemand sagt, dass irgendwo eine Bombe versteckt ist. Aber oft sind solche Drohungen nicht echt, sondern nur ein böser Streich, der für Angst und Schrecken sorgt.
Die Polizei nimmt das trotzdem sehr ernst, weil es wichtig ist, alle Menschen zu schützen und für Sicherheit zu sorgen. Am Montagmorgen wurden die Schülerinnen und Schüler und das Lehrpersonal vieler Schulen zur Vorsicht in Sicherheit gebracht. Es wurden Straßen abgesperrt und der Verkehr umgeleitet. Sprengstofffachleute waren unterwegs und Bewohnerinnen und Bewohner der angrenzenden Wohnungen waren dazu aufgerufen, ihre Wohnungen nicht zu verlassen.
Polizisten im Einsatz
Polizisten, Sprengstoffexperten und andere Fachleute waren an den Einsatzorten. Am Nachmittag war der Polizeieinsatz beendet. Eine Bombe wurde an keinem der Standorte gefunden. Nach so einem erschreckenden Ereignis ist die Suche nach dem Verfasser des Textes wichtig. „Die Verursacher haben mit hohen Strafen zu rechnen“, heißt es vonseiten des Innenministeriums.
Wenn Nachrichten Angst machen
Gerade gibt es viele schlimme Meldungen im Fernsehen, den Zeitungen und im Internet. Diese Bilder machen vielen Menschen Angst. Dir vielleicht auch. Das ist ganz verständlich. Wenn etwas passiert, das neu oder mit Gewalt oder mit Zerstörung verbunden ist, dann haben Menschen oft automatisch Angst. Das ist ein ganz natürliches Gefühl, das auftritt.
Rede darüber!
Wenn du Angst hast, hilft es, darüber zu reden, zum Beispiel mit deinen Eltern, anderen Verwandten, Lehrern oder jemandem, dem du vertraust. Wenn man gut über eine Situation Bescheid weiß, wird sie weniger beängstigend. Frag einfach nach. Und hör erst damit auf, wenn du auch alles verstanden hast.
Hilfe von Profis
Es gibt auch Profis, die dich gerne beraten. Unter der Telefonnummer 147 von Rat auf Draht kannst du zum Beispiel rund um die Uhr anrufen und über deine Angst reden. Wenn du nicht so gerne telefonierst, kannst du dort auch online im Internet Fragen stellen. Die Hilfe kostet auch nichts.
Abdrehen und ausschalten
Du musst all diese Nachrichten nicht lesen oder anschauen, auch nicht, wenn du sie von Freunden auf dein Handy geschickt bekommst. Sag einfach „Stopp!“. Wenn dir alles zu viel wird, dann leg das Handy zur Seite, dreh den Fernseher ab und mache etwas ganz anderes.