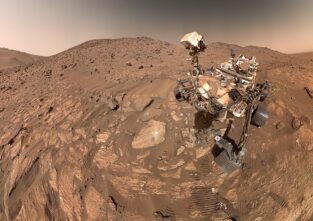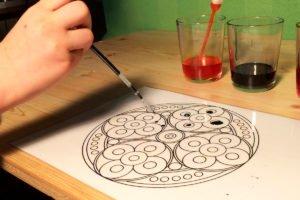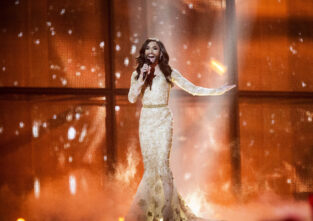Warum es Streit um die Ostukraine gibt
Die Angst vor einem Krieg in der Ukraine wächst. Was dahinter steckt.


Ein Streit in der Ukraine spitzt sich gerade zu. Immer öfter wird davon gesprochen, dass es in dem Land im Osten Europas sogar Krieg geben könnte. Aber was ist da überhaupt los?
Um einen Teil der Ukraine gibt es seit vielen Jahren einen erbitterten Streit und blutige Kämpfe. Tausende Menschen sind deshalb in den vergangenen acht Jahren auch schon gestorben. Genau gesagt, geht es dabei auch um die Ostukraine. Die Ostukraine ist ein Teil der Ukraine, der im Osten des Landes liegt. Das Gebiet gehört zur Ukraine. Aber: Das Nachbarland Russland sagt, dass es auch Anspruch auf dieses Gebiet habe. Einen Teil der Ukraine, nämlich die Insel Krim, hat Russland sogar annektiert. Das heißt, Russland hat Soldaten dorthin geschickt und gesagt, die Insel gehört zu Russland. Der Grund dafür ist sehr kompliziert und liegt in der Geschichte der Länder.
Angst vor Krieg wächst
Gerade wird wieder besonders heftig um die Ostukraine gestritten. Russland hat sogar mehr als 100.000 Soldaten an die Grenze zur Ukraine geschickt. Die Menschen in der Ukraine befürchten, dass die russischen Soldaten ihr Land angreifen könnten. Einige Menschen in der Ostukraine würden sogar wollen, dass ihr Gebiet zu Russland gehört. Dort leben nämlich viele Menschen mit russischen Wurzeln. Sie wollen, dass ihr Land eng mit Russland verbunden ist. Viele andere in der Ukraine wollen aber, dass die Ostukraine weiter ein Teil der Ukraine bleibt und eher eng mit der Europäischen Union zusammenarbeitet.
Wer noch mitmischt
Dass die Ostukraine ein Teil der Ukraine bleibt, wollen auch viele westliche Staaten der sogenannten Nato. Die Nato ist ein Bündnis von Ländern. Die Ukraine ist noch kein Mitglied der Nato. Die Nato-Länder haben einander versprochen, sich zu unterstützen, sollte eines der Länder angegriffen werden. Die USA, Frankreich oder Deutschland gehören der Nato an. Sie haben dort viel zu sagen. Der Streit zwischen der Ukraine und Russland betrifft also nicht mehr nur diese beiden Länder, sondern auch die Nato. Russland hat nämlich Angst, dass die Ukraine ein Teil der Nato werden könnte.
Die Nato sagt, sie will den Streit in Frieden lösen. Wenn es sein muss, schickt die Nato aber auch Soldaten in die Ostukraine. Der Präsident von Russland, Wladimir Putin, will nicht, dass sich die Nato in den Streit einmischt. Er sagt, dass er gar nicht vorhat, die Ostukraine anzugreifen. Im Gegenteil: Er und sein Land fühlen sich durch die Einmischung der Nato bedroht.
Wie geht es weiter?
Die Lage sei sehr ernst, meinen mehrere Politiker. Niemand weiß genau, welche Schritte Russland weiter unternehmen wird. Würde es Krieg geben, hätte das nicht nur schlimme Folgen für die Menschen in der Ukraine. Das würde auch andere Länder betreffen. Deshalb ist es wichtig, dass die Politiker der Länder jetzt viel miteinander reden. So könnte der Streit noch friedlich gelöst werden.
Was sind Sanktionen?
Wenn sich zwei Länder streiten, ist immer wieder die Rede von Sanktionen. Sanktionen sind eine Art Strafandrohung. So wie wenn deine Eltern dir drohen, dass du Handyverbot hast, wenn du deine Hausaufgaben nicht machst. Im Streitfall zwischen der Ukraine und Russland wird Russland von den Nato-Ländern mit Sanktionen gedroht. Sie sagen: Wenn ihr der Ukraine weiter droht und Soldaten schickt, dann kaufen wir euch kein oder weniger Gas mehr ab. Russland lebt zu einem guten Teil davon, dass es Gas verkauft. Ob die Sanktionen wirklich nützen, ist aber fraglich. Denn die Nato-Länder brauchen auch das Gas. Damit wird dort nämlich nicht nur geheizt, auch viele Firmen brauchen es, um arbeiten zu können.
Auf dem Plan siehst du, wo die Ukraine liegt:
Weitere Beiträge:
Aktionsabo
15 Wochen für 15 Euro

- 15 Wochen gratis lesen, nur 15 Euro zahlen
- Jeden Samstag eine neue Ausgabe
- Aktuelle Nachrichten kindgerecht aufbereitet