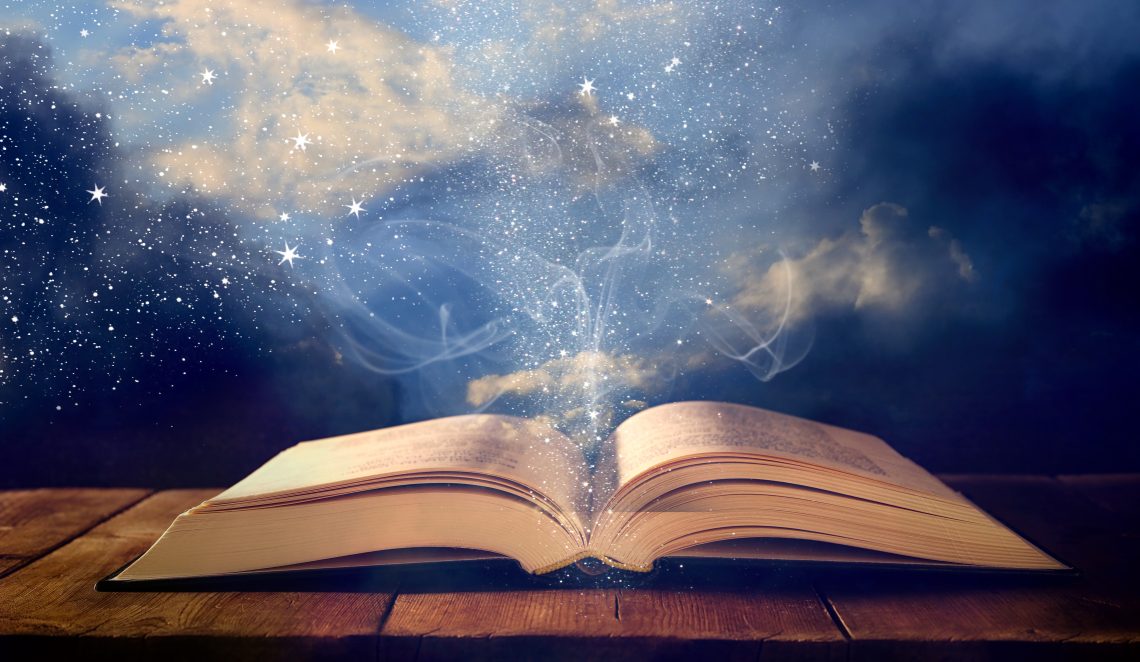Parteien: Wer in einer Demokratie bestimmt
Wie kann man erreichen, dass Millionen Menschen mitentscheiden, was in einem Land passiert? Man gründet Parteien.
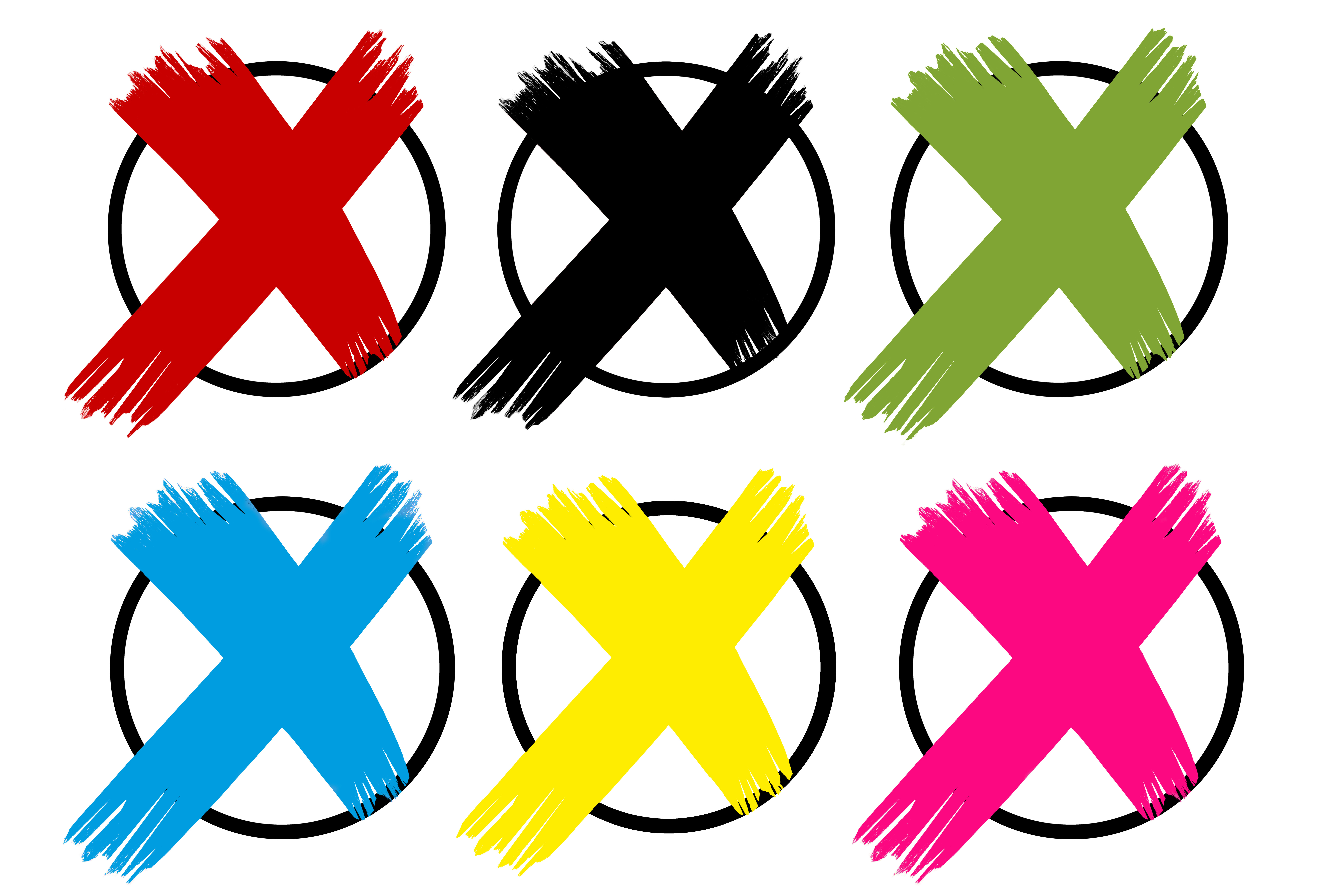
Wenn Erwachsene über Politik und Parteien reden, kommt es vor, dass aus diesem Gespräch ein Streit wird. Streiten gehört zu einer Demokratie, wo alle ihre Meinung sagen dürfen. Weil es zu verschiedenen Dingen unterschiedliche Meinungen gibt, streiten auch Politikerinnen und Politiker miteinander, vor allem, wenn etwas ausverhandelt werden soll. Und, wenn Politikerinnen und Politiker verschiedenen Parteien angehören. Im Folgenden erfährst du, was Parteien sind und wozu wir sie brauchen.
Was ist eine Partei?
In einer Partei schließen sich Leute zusammen, die ähnliche Meinungen und gleiche Ziele haben, wenn es zum Beispiel um die Schule, die Arbeit, Umweltschutz oder das Zusammenleben geht. Die Ideen, die die Menschen dazu haben, werden in einem Parteiprogramm aufgeschrieben. Und weil es zu all den Themen verschiedene Meinungen und für Probleme oft mehrere Lösungen gibt, gibt es auch verschiedene Parteien. In einer Demokratie, wie es sie in Österreich gibt, kann jeder Mensch Mitglied einer Partei werden. Man muss jedoch nicht. Es kann aber auch jede und jeder, die oder der wählen darf, eine Partei gründen und so selbst Politik machen.
Wozu brauchen wir Parteien?
Früher, im alten Griechenland, sind alle Menschen auf einem Platz zusammengekommen und es wurde abgestimmt. In einer modernen Demokratie wird heute die Mitsprache des Volkes über Parteien geregelt. Bei Wahlen geben die Menschen ihre Stimme einer Partei, die ihre Ansichten und Vorstellungen am besten vertritt. Den einen ist es zum Beispiel wichtig, dass die Politik viele Gesetze für den Umweltschutz beschließt. Die anderen wollen, dass in Österreich möglichst viele Firmen gegründet werden, damit die Leute Arbeit haben. Und wiederum andere geben der Partei die Stimme, die sich dafür einsetzen will, dass nicht zu viele Flüchtlinge ins Land kommen.
Was machen Politiker?
Politikerinnen und Politiker sind Vertreterinnen und Vertreter des Volkes. Sie arbeiten sich in verschiedene Themen wie Schule, Gesundheit oder Verkehr ein, damit sie sich gut auskennen. Mit diesem Wissen und der Hilfe von Expertinnen und Experten machen sie Gesetze, die für alle Menschen im Land gelten. Ein Politiker und eine Politikerin sollte also wissen, wie die Leute denken und was sie brauchen. Und es ist wichtig, dass er oder sie mit der Stimme, die ihm oder ihr der Wähler oder die Wählerin gegeben hat, verantwortungsvoll umgeht. Aber auch die Wähler und Wählerinnen sollten mit ihrer Stimme verantwortungsvoll umgehen und sich gut überlegen, welcher Partei sie sie geben.
Wer hat in Österreich die nächsten fünf Jahre das Sagen? Das entscheidet sich bei der Nationalratswahl am Sonntag. Mehr dazu findest du hier.