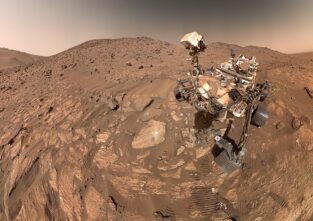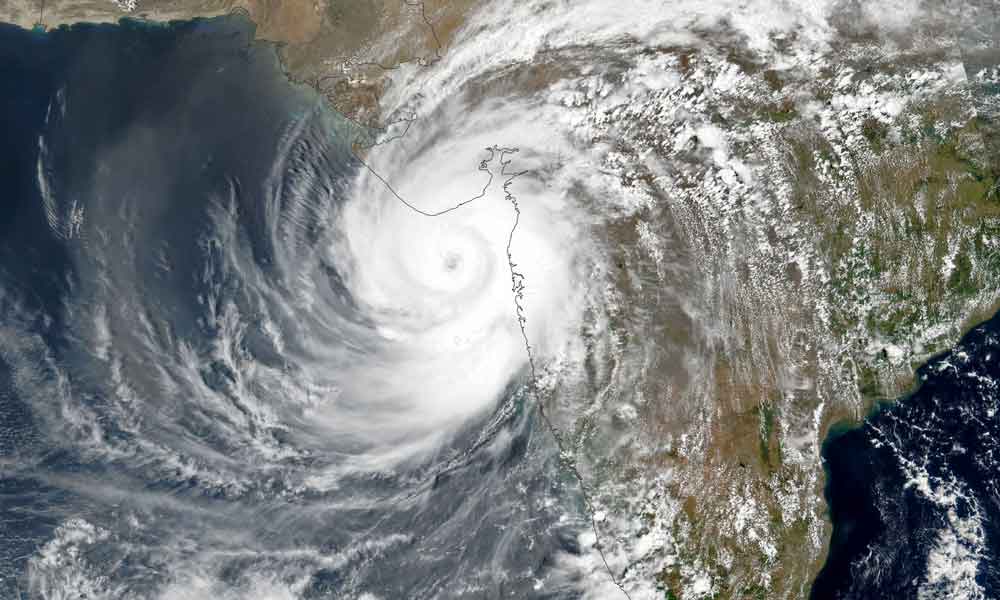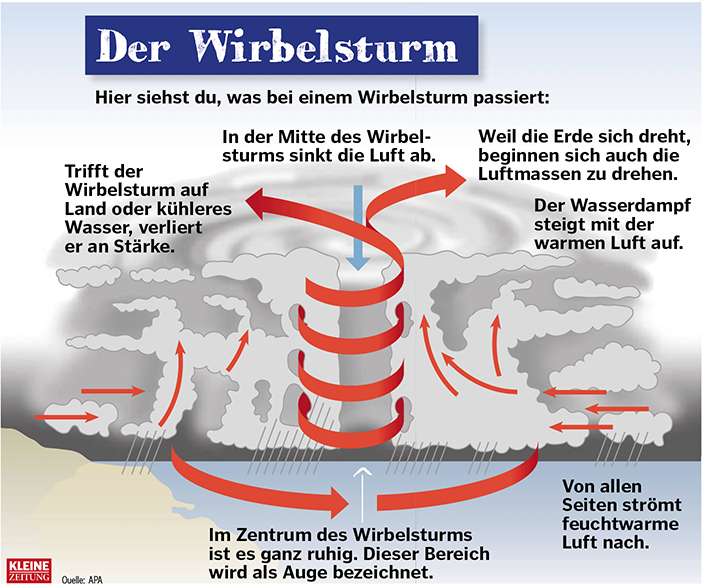Pfingsten: Wenn die Kirche Geburtstag feiert
Es gibt schon wieder etwas zu feiern: 50 Tage nach Ostern wartet das nächste große Fest auf alle gläubigen Christen. Warum dabei Tauben ihren großen Auftritt haben und warum alle Feiernden quasi Geburtstagsgäste sind.

Neben Weihnachten und Ostern ist Pfingsten ein weiteres Fest, das im Christentum sehr wichtig ist. Immer 50 Tage nach Ostern feiern gläubige Christen die Entsendung des sogenannten Heiligen Geistes. 50 Tage nach Ostern hat sich der Heilige Geist nämlich zum ersten Mal den Anhängern von Jesus gezeigt. Der Heilige Geist ist aber kein Gespenst. Er taucht zum Beispiel in der Bibel immer dann auf, wenn Gott ein Wunder vollbringt. Das Zeichen für den Heiligen Geist ist die Taube. So wird er oft in Büchern oder Kirchen dargestellt.
Der Heilige Geist ist so wie Jesus auch ein Teil Gottes. Gott hat nämlich drei Teile: den Vater, den Sohn (Jesus) und den Heiligen Geist. Man nennt das auch Dreifaltigkeit.
Pfingsten in der Bibel
In der Bibel steht viel über Pfingsten geschrieben. Dort heißt es zum Beispiel, dass die Anhänger von Jesus zusammensaßen, als es draußen plötzlich ganz laut wurde. Am Himmel waren Zungen aus Flammen zu sehen. Diese Flammenzungen setzten sich über die Anhänger von Jesus. Als das passierte, konnten alle fremde Sprachen sprechen, obwohl sie sie nie gelernt hatten. Damit wurden die Anhänger von Jesus aufgefordert, in die Welt hinauszugehen und allen von Jesus und seinen guten Taten und Ideen zu erzählen. Pfingsten war also so etwas wie der Startschuss dafür, dass das Christentum entstand. Es ist eine Art Geburtstag für die Kirche.
Das Wort „Pfingsten“ leitet sich übrigens vom griechischen „pentekoste“ (deutsch: „der 50. Tag“) ab. Der Pfingstsonntag fällt dieses Jahr auf den 23. Mai. Am Tag danach ist Pfingstmontag. In Österreich ist der Pfingstmontag übrigens auch ein gesetzlicher Feiertag. Das heißt, die Kinder müssen nicht in die Schule und viele Menschen müssen nicht arbeiten.
Weitere Beiträge:
Aktionsabo
15 Wochen für 15 Euro

- 15 Wochen gratis lesen, nur 15 Euro zahlen
- Jeden Samstag eine neue Ausgabe
- Aktuelle Nachrichten kindgerecht aufbereitet