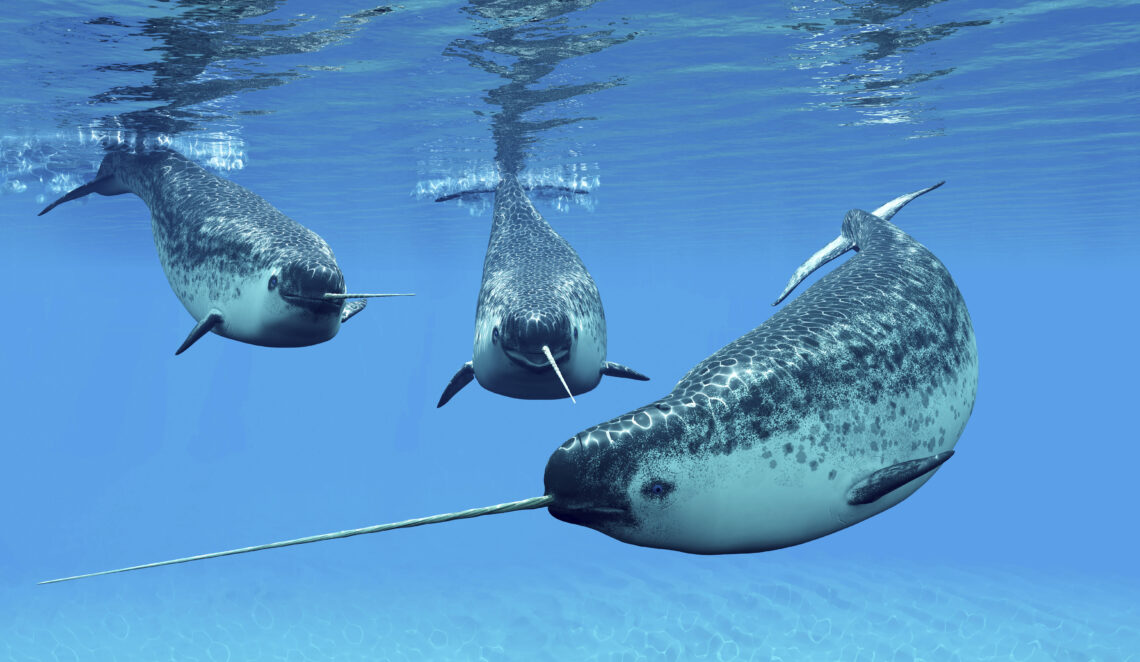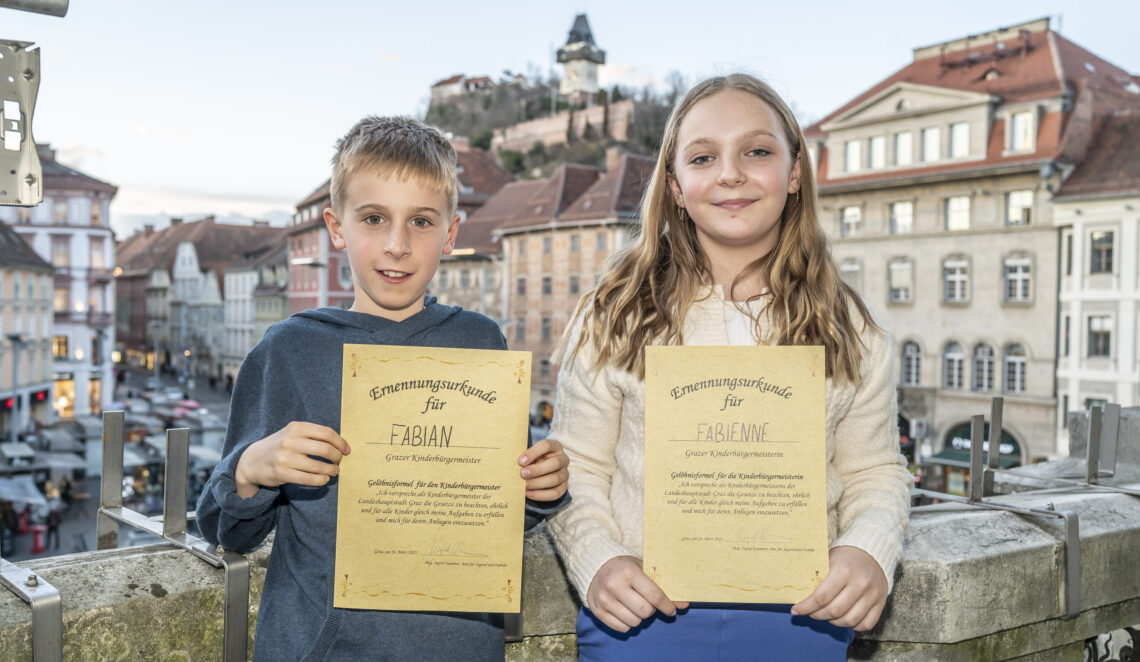Neun Monate im All: Astronauten sind wieder zurück
Wie geht es Astronauten, wenn sie lange Zeit im All leben? Das erklärt die Forscherin Ines Flößl.

Mehr als neun Monate haben die US-Astronauten Suni Williams und Barry Wilmore auf der Internationalen Raumstation ISS verbracht. Eigentlich sollten sie nur fünf Tage bleiben. Doch dann gab es technische Probleme mit ihrem Raumschiff und die beiden konnten erst jetzt zurückkehren. Am Mittwoch, dem 19. März, landeten sie schließlich mit einer Raumkapsel auf der Erde, zusammen mit zwei weiteren Astronauten.
Wie wirkt sich ein so langer Aufenthalt im All auf den Körper aus? Diese Frage erforscht die Wissenschaftlerin Ines Fößl von der Medizinischen Universität Graz.

Schweben statt gehen
Nach einer langen Zeit im All können Astronauten oft nicht sofort laufen. Deshalb mussten die Astronauten nach der Landung im Liegen transportiert werden. „Im Weltall gibt es keine Schwerkraft, die den Körper nach unten zieht. Muskeln und Knochen, die wir auf der Erde brauchen, um stabil zu stehen und uns zu bewegen, werden im All nicht gebraucht. Daher werden die Muskeln weniger und die Knochen dünner. Außerdem beeinflusst die Schwerelosigkeit unseren Gleichgewichtssinn“, erklärt Fößl.
Weniger Muskeln
Obwohl Astronautinnen und Astronauten jeden Tag auf der Raumstation mehr als zwei Stunden trainieren müssen, reicht das nicht aus. „Auf der Erde müssen wir bei jedem Schritt gegen die Schwerkraft arbeiten. Das trainiert unsere Muskeln automatisch. Im All gibt es diesen Widerstand nicht, sodass sich die Muskulatur zurückbildet“, sagt die Forscherin. Dort gibt es keine Schwerkraft. Das führt dazu, dass die Muskeln weniger werden.
Dünnere Knochen
Auch die Knochen bauen sich ab. „Damit Knochen stark bleiben, brauchen sie Druck. Auf der Erde spüren sie unser Körpergewicht. Im All gibt es diesen Druck nicht. Deshalb werden die Knochen dünner und leichter“, erklärt die Forscherin.
Gefährliche Strahlung
Im All gibt es mehr Strahlung als auf der Erde. „Unsere Atmosphäre schützt uns normalerweise davor“, erklärt Fößl. Raumfahrtorganisationen wie die NASA berechnen aber genau, wie viel Strahlung Astronauten aushalten können, um nicht krank zu werden.
Lange Erholung
Nach der Rückkehr auf die Erde muss sich der Körper erst wieder an die Schwerkraft gewöhnen. „Muskeln und Knochen bauen sich wieder auf. Aber das dauert genauso lange, wie die Astronauten im All waren“, sagt Fößl. Wer fast zehn Monate oben war, braucht also auch fast zehn Monate, um sich zu erholen.
Wichtige Forschung
Die Forschung nützt nicht nur den Astronauten und für Flüge ins All. „Wenn wir verstehen, was Schwerelosigkeit mit dem Körper macht, können wir auch Menschen auf der Erde helfen“, sagt Fößl. Zum Beispiel kranken Menschen, die lange im Bett liegen und sich kaum bewegen können.
Willst du mehr über die Raumstation ISS verfahren?
- Hier erfährst du, was es mit der „ISS“ auf sich hat.
- 2023 sind drei Männer nach einem Jahr im All wieder auf die Erde zurückgekehrt. Welchen Rekord sie aufgestellt haben, kannst du hier lesen.
- Was ist Weltraumschrott und welche Probleme sind schon einmal damit aufgetreten? Hier kannst du dich informieren.