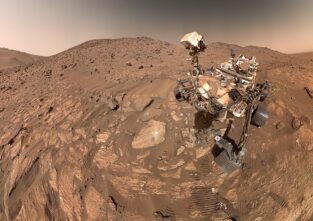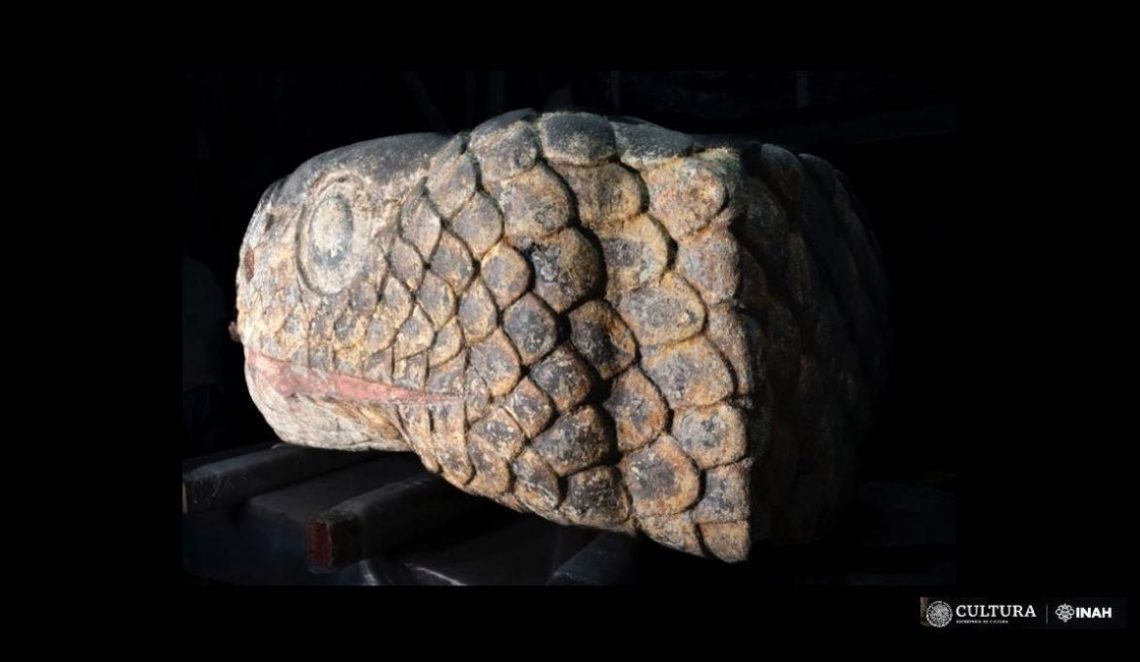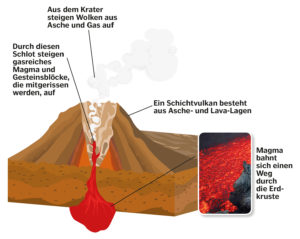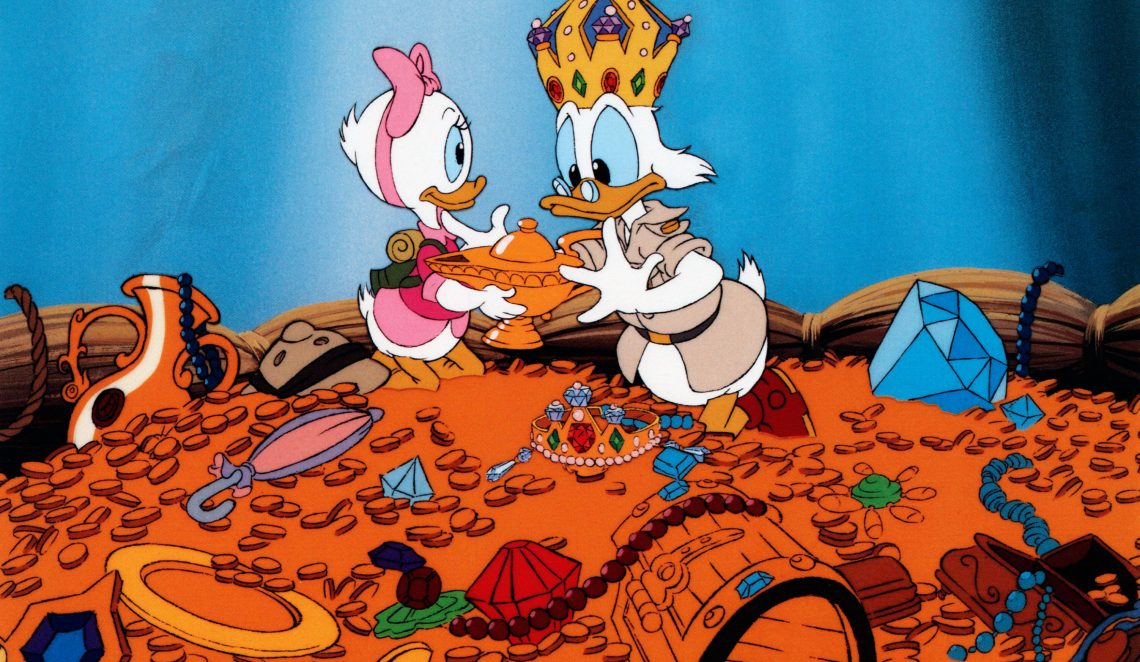Einfach erklärt: Was ist ein Streik?
Diese Woche streiken einige Menschen in Österreich. Das bedeutet, dass sie nicht zur Arbeit erscheinen. Der Grund dafür ist aber nicht, dass sie einfach keine Lust haben!

Das Wort Streik hast du in letzter Zeit vielleicht einmal gehört oder gelesen. Das ist kaum verwunderlich, denn in Österreich wird nun wieder gestreikt. Und das, obwohl Streiks in unserem Land eher selten sind. Wir erklären dir, warum das so ist und was hinter diesem Wort steckt.
Streik bedeutet, dass Menschen nicht zur Arbeit gehen. Aber nicht etwa, weil sie faul sind oder einfach keine Lust haben. Sie machen das, um zu protestieren – weil sie die Bedingungen, unter denen sie arbeiten müssen, ungerecht finden. Sehr oft geht es dabei um Geld. Genauer gesagt, um den Lohn, den die Menschen für ihre Arbeit bekommen.
Wie funktioniert ein Streik?
Durch einen Streik soll Druck auf Firmen und Betriebe ausgeübt werden. Ein Streik ist ein Mittel, um zu sagen: „Das wollen wir nicht. So geht das nicht.“ Denn kommen die Menschen nicht zur Arbeit, stehen die Maschinen still. Niemand arbeitet und es werden keine Produkte hergestellt und keine Dinge erledigt.
Und genau das setzt die Menschen, die beim Geld das Sagen haben, unter Druck. Denn immerhin wollen sie, dass die Arbeit erledigt wird. Erscheint niemand in der Firma oder dem Betrieb, ist das auch teuer. Du kannst dir das so vorstellen: Gibt es zum Beispiel Streik in einer Firma, die Werkzeug herstellt, wird an den Tagen, an denen es Streik gibt, kein Werkzeug gefertigt. Dadurch gibt es auch nichts, was der Betrieb verkaufen kann.
Und in Österreich?
Auch jetzt ist Geld der Grund für die Streiks. 200 Betriebe in Österreich machen dabei mit. Sie alle gehören zur sogenannten Metalltechnischen Industrie. Oft werden diese auch „Metaller“ genannt. Das sind Firmen, die auf unterschiedliche Art Metall verarbeiten.
Jedes Jahr verhandeln die Metaller ihren Lohn. Das heißt, verschiedene, ausgewählte Menschen setzen sich an einen Tisch. Gemeinsam wollen sie sich einigen, wie viel Gehalt die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, verdienen sollen. Das Gehalt wird jedes Jahr neu verhandelt. Ein Grund dafür ist zum Beispiel, dass viele Dinge teurer werden. Damit die Menschen sich mit ihrem Lohn weiterhin ihre Wohnung, Lebensmittel und andere Dinge leisten können, wollen sie mehr Geld verdienen.
Wie lange dauert der Streik
Dieses Jahr haben es die Verantwortlichen aber nicht geschafft, sich zu einigen. Die Arbeitenden sagen, dass der Lohn, den sie bekommen sollen, nicht genug ist. Um doch noch ihre Wünsche durchzusetzen, treten sie jetzt den Streik an.
Wie viele Tage gestreikt wird, ist noch nicht klar. Das hängt davon ab, ob man bei Verhandlungen eine gemeinsame Lösung findet. Eine Lösung, mit der alle zufrieden sind. Solche Verhandlungen könnte es demnächst wieder geben.