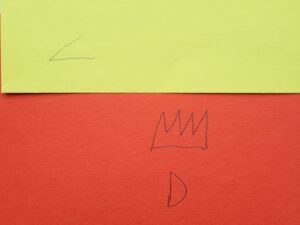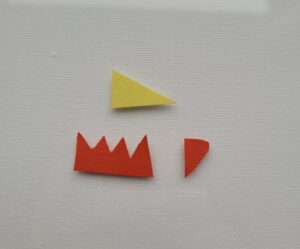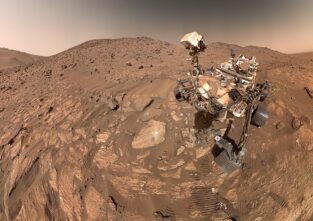Drillinge! Luchs-Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn
Im Tiergarten Schönbrunn leben Eurasische Luchse. Seit Mai gibt es gleich dreifachen Nachwuchs: Mama Luchs hat Drillinge zur Welt gebracht.

Diese Wildkatze ist die größte in Europa – wenn sie auf die Welt kommt, ist sie trotzdem ganz schön klein: Gerade einmal 300 Gramm wiegt ein Jungtier des Eurasischen Luchses. Das ist so viel wie drei Tafeln Schokolade.
Zuerst blind, jetzt schon unterwegs
Im Mai sind im Tiergarten Schönbrunn in Wien drei dieser Katzen auf die Welt gekommen. Und zwar blind und völlig hilflos. Dass es Drillinge sind, ist außergewöhnlich – normalerweise kommen Einzeltiere oder Zwillinge zur Welt.
Mama Luchs hat sich in den ersten Wochen um ihre drei Kleinen gekümmert, ganz geschützt in einer Hütte. Jetzt kommen die Drillinge heraus: „Mittlerweile erkunden sie neugierig das große Waldgehege, schleichen sich an und jagen sich gegenseitig – ganz nach Katzenmanier“, sagt Stephan Hering-Hagenbeck. Er ist der Direktor des Tiergartens.

„Pinsel“ und andere Besonderheiten
Typisch für den Eurasischen Luchs sind ein kurzer Schwanz mit schwarzer Spitze und recht langen Beine. Und eben die Größe. Bei den kleinen Luchsen sind auch schon die „Pinsel“ zu sehen – das sind die typischen langen Ohrbüschel. Sie werden bis zu sechs Zentimeter lang. Diese Büschel helfen Luchsen dabei, sehr gut zu hören. Das ist auch der Grund, weshalb wir sie außerhalb des Zoos selten sehen können – sie hören uns schon viel früher und gehen uns Menschen aus dem Weg. Ein anderer Grund, warum wir sie in unseren Wäldern nicht sehen: Es gibt nur mehr wenige von ihnen. In Österreich leben geschätzt nur 35. Darum ist es auch so besonders und wichtig, wenn im Tiergarten Nachwuchs kommt.
Im Jahr 2022 war der Luchs „Tier des Jahres“. Hier kannst du mehr über ihn und andere Tiere nachlesen.