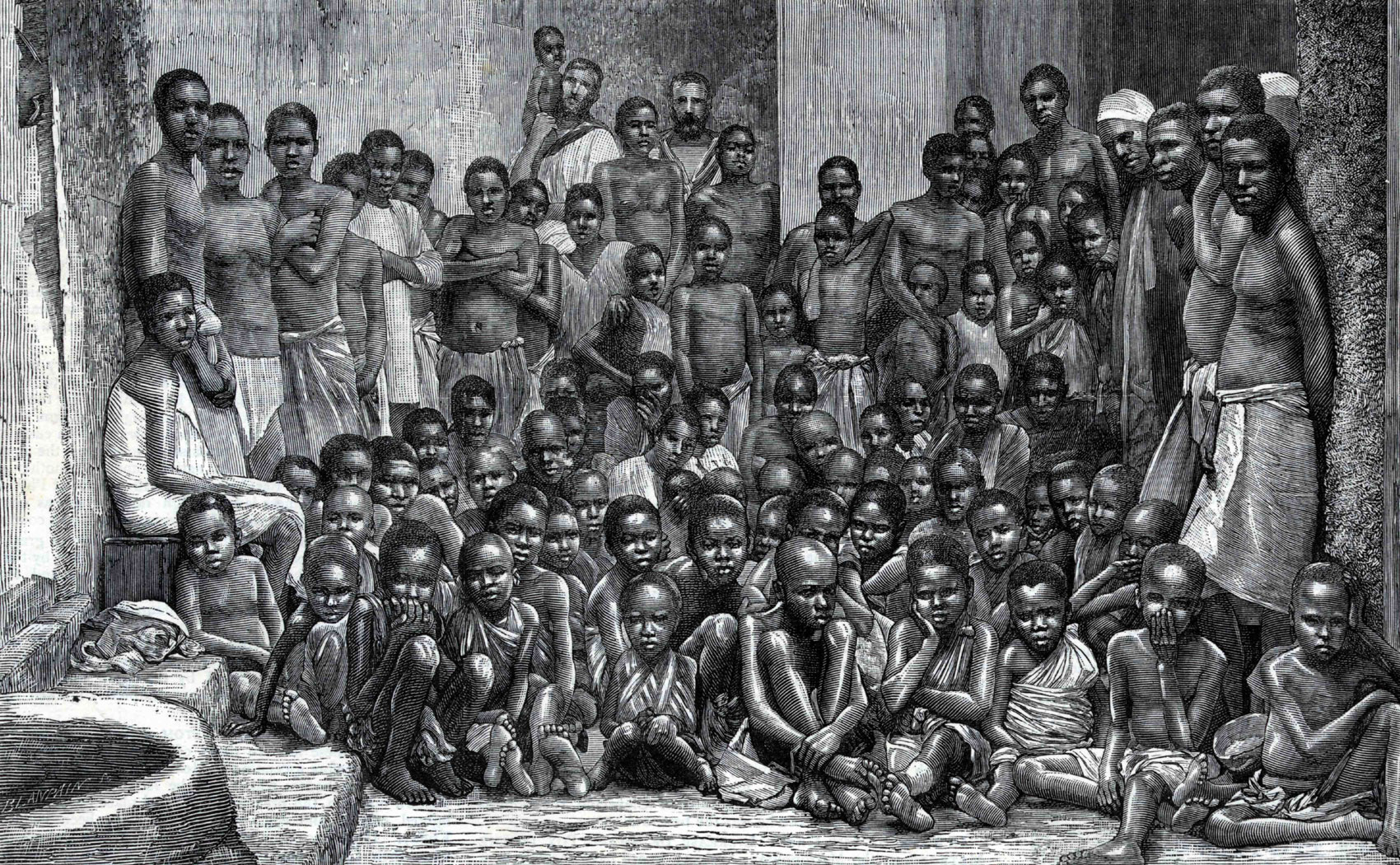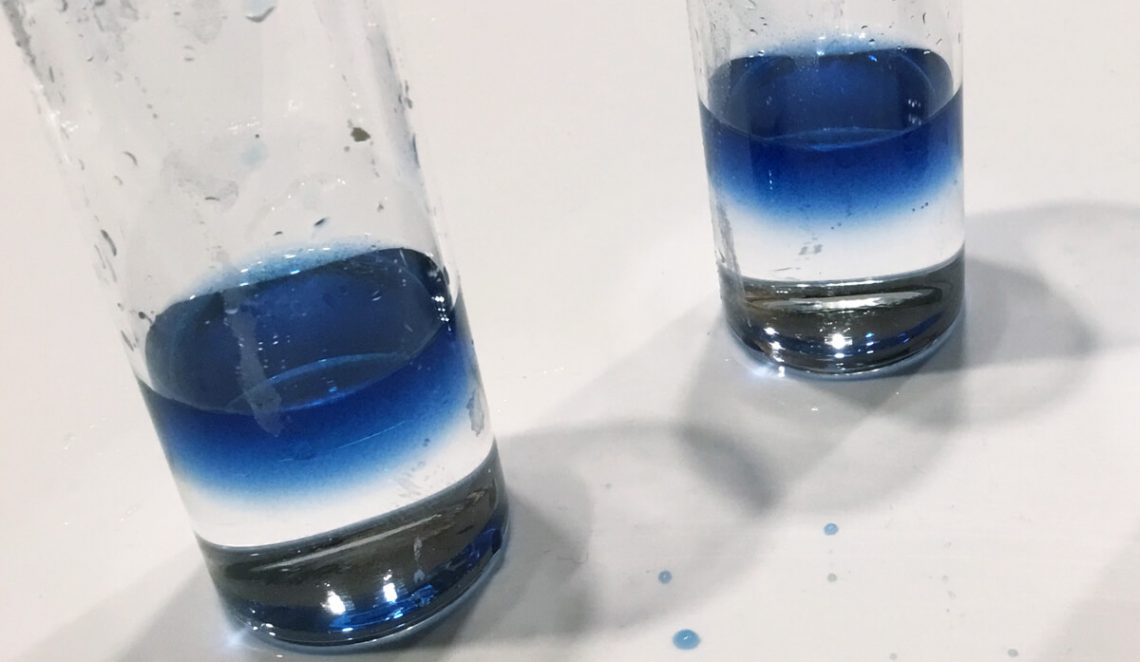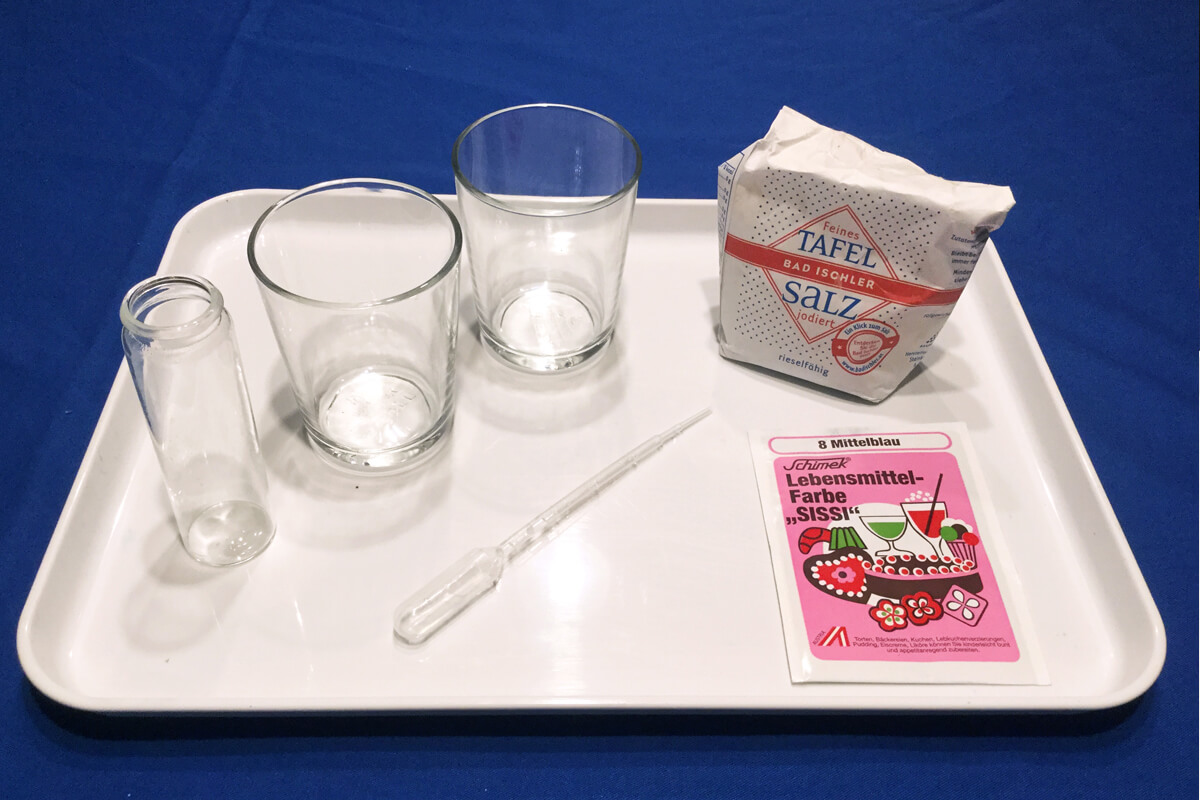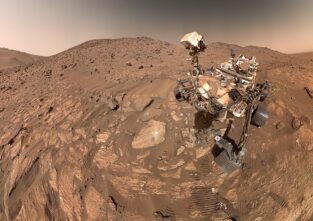Schwerer Sturm: Das ist zu tun
Diese Dinge solltest du bedenken, wenn plötzlich ein schwerer Sturm aufzieht.

Vergangene Woche gab es in Teilen Österreichs schlimme Unwetter. Mehrere Menschen starben dabei, auch Kinder. Sie wurden von den Unwettern überrascht. Die Unwetter kamen nämlich plötzlich und sehr heftig. Vor allem sehr starker Wind sorgte für einen Ausnahmezustand. Er erreichte Geschwindigkeiten von mehr als 130 Stundenkilometern. Das ist so schnell, wie Autos auf der Autobahn fahren dürfen. Viel Zeit für Vorwarnungen blieb nicht.
Tipps für deine Sicherheit
Jetzt stellen sich natürlich viele Menschen die Frage: Wie schütze ich mich in so einer Situation am besten? Wir haben ein paar Tipps für dich zusammengestellt, was du bei einem schweren Sturm beachten solltest.
- Wälder, alleinstehende Bäume und Parkanlagen meiden! Äste könnten herunterbrechen.
- Zu Strommasten, Gerüsten oder älteren Gebäuden mindestens 20 Meter Abstand halten. Ziegel könnten vom Wind abgetragen werden.
- Bist du in der Nähe eines Autos, kannst du darin Schutz suchen. Aber Vorsicht! Das Auto sollte nicht unter einem Baum abgestellt sein. Autos bieten übrigens auch einen guten Schutz vor Blitzen.
- Bist du mit deinen Eltern gerade im Auto unterwegs, Brücken meiden! Der Wind hat dort besonders viel Kraft. Ab besten mit dem Auto an einer ungefährlichen Stelle stehen bleiben und das Unwetter abwarten.
- Radio einschalten und die Tipps der Autofahrerclubs befolgen!
- Daheim, in der Schule und in Gebäuden allgemein Fenster und Türen schließen und absperren. Rollos herunterlassen. Nicht ans Fenster stellen. Die Scheiben könnten zu Bruch gehen.
- Am Campingplatz: Schutz in gemauerten Sanitäreinrichtungen (WC und Duschen) suchen. Zelte und Wohnwägen sind nicht sicher.
Gut zu wissen: Fachleute sind der Meinung, dass die Unwetter von vergangener Woche sehr schwer vorherzusagen waren. In Zukunft könnte das Wetter immer öfter unberechenbar sein. Das hat mit dem Klimawandel zu tun. In Österreich arbeiten Expertinnen und Experten deshalb an einer Möglichkeit, wie die Menschen schnell vor solchen Unwettern gewarnt werden können.
Aktionsabo
15 Wochen für 15 Euro

- 15 Wochen gratis lesen, nur 15 Euro zahlen
- Jeden Samstag eine neue Ausgabe
- Aktuelle Nachrichten kindgerecht aufbereitet