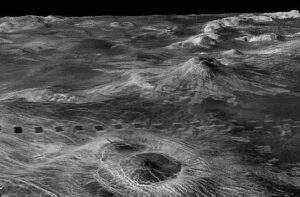Was kann ich tun, wenn ich Sorge habe, in die Schule zu gehen?
Du machst dir derzeit Gedanken, ob es sicher ist, in die Schule zu gehen? Was du dann machen könntest und was dir helfen kann.

Die Nachrichten der vergangenen Tage sind beklemmend. Es wurde viel über den Angriff an einer Grazer Schule und Bombendrohungen an anderen Schulen gesprochen. Es ist vollkommen verständlich, sich darüber Gedanken zu machen. Es ist auch normal, sich Sorgen zu machen.
Du hast vielleicht Angst, dass so etwas auch an deiner Schule passieren könnte. Ganz wichtig: Bei den Bombendrohungen ermittelt die Polizei immer ganz genau und bringt sicherheitshalber immer alle an einen anderen Ort. Und so etwas wie diese schlimme Tat in Graz kommt sehr, sehr selten vor. In Österreich gab es das so überhaupt noch nie. Die Wahrscheinlichkeit, dass es noch einmal passiert, ist bei uns sehr gering.
Soll ich weiter hingehen?
Dass du besorgt bist, ist dennoch ganz normal. Du möchtest vielleicht am liebsten gar nicht in die Schule gehen. Ist das sinnvoll? Nein. Expertinnen und Expertinnen raten dazu, so normal wie möglich weiterzumachen. Der Alltag und deine Mitschüler zu treffen, tut uns gut.
Gemeinsam zur Schule gehen
Aber was könntest du da machen, wenn du Angst hast, in die Schule zu gehen?
„Du könntest dich zum Beispiel mit einem Kind aus deiner Nachbarschaft verabreden. Geht oder fahrt gemeinsam mit dem Bus hin. Du musst nicht allein zur Schule gehen“, erklärt Ärztin Katharina Purtscher-Penz.
Im Sesselkreis sprechen
Auch die Schule selbst ist ein Ort, an dem man sprechen kann. Vielleicht nehmen deine Lehrerinnen und Lehrer dich und deine Schulfreunde derzeit ja gleich schon in Empfang. Und vielleicht sprecht ihr auch gleich ein bisschen miteinander.
„Dann schau in der Schule, wie es dir geht“, sagt Katharina Purtscher-Penz. Kannst du dich entspannen? Zum Beispiel, wenn du mit deinen Freundinnen zusammen bist? „Wenn nicht, dann kannst du das deiner Lehrerin erzählen“, sagt die Ärztin. Du kannst auch mit Mama oder Papa sprechen oder mit jemand anderem, dem du vertraust. Das können auch Geschwister oder Freunde sein.
Vielleicht geht es ja auch deinen Freundinnen und Freunden ähnlich. Ihr könnt gemeinsam darüber sprechen. „Eine gute Möglichkeit dazu ist, euch in einer Runde zusammenzusetzen“, schlägt Katharina Purtscher-Penz vor. Das kann zum Beispiel in der Schule ein Sesselkreis sein.
Glücksbringer in der Hosentasche
Hast du einen kleinen Glücksbringer? „Du könntest ihn mitnehmen. Dann kannst du manchmal in deine Hosentasche greifen. Und nur du weißt, dass er da ist“, sagt Katharina Purtscher Penz.
Du hast derzeit auch Probleme beim Einschlafen? Was du dann machen kannst, kannst du hier nachlesen.
Nachrichten bereiten dir Sorgen? Was du dann machen kannst, dazu kannst du mehr hier nachlesen.
Katharina Purtscher-Penz ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Mitbegründerin des Kriseninterventionsteams des Landes Steiermark. Das Team hilft Menschen in schweren Situationen im Leben. Mehr darüber erfährst du hier. Wenn du Angst hast oder einfach reden möchtest, hören dir auch die Experten und Experten von Rat auf Draht gerne und kostenlos zu. Du erreichst sie rund um die Uhr unter 147. Wenn du nicht telefonieren magst, kannst du dich auch online oder per Mail an Rat auf Dreht wenden.
Hier haben wir für dich zusammengefasst, was du tun kannst, wenn dir Nachrichten Angst machen.