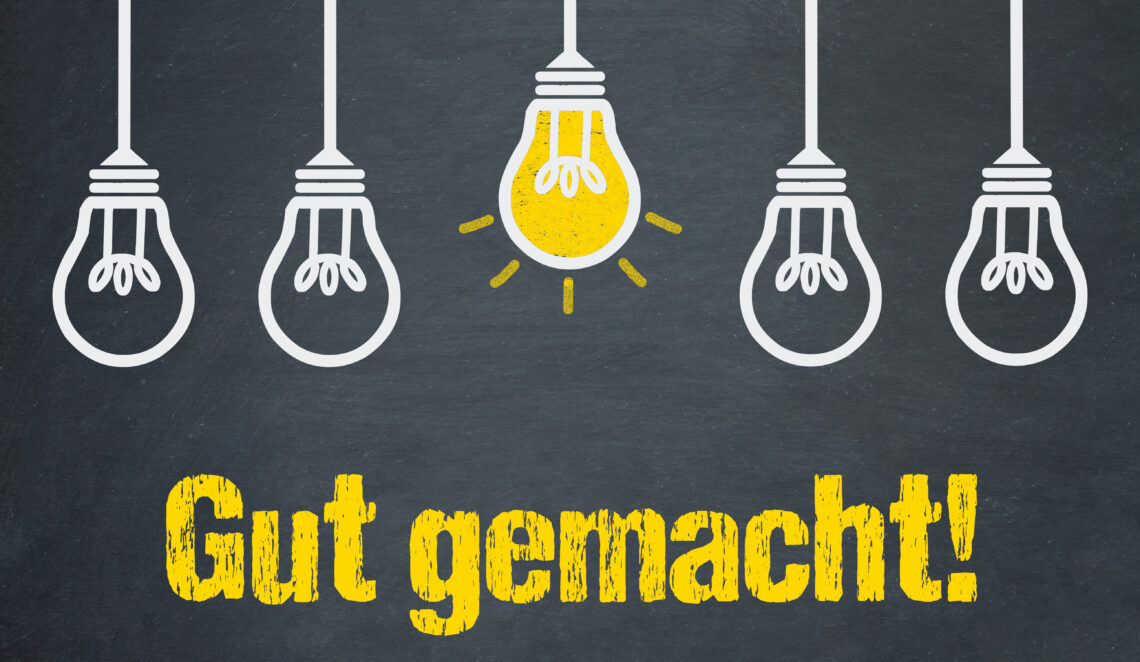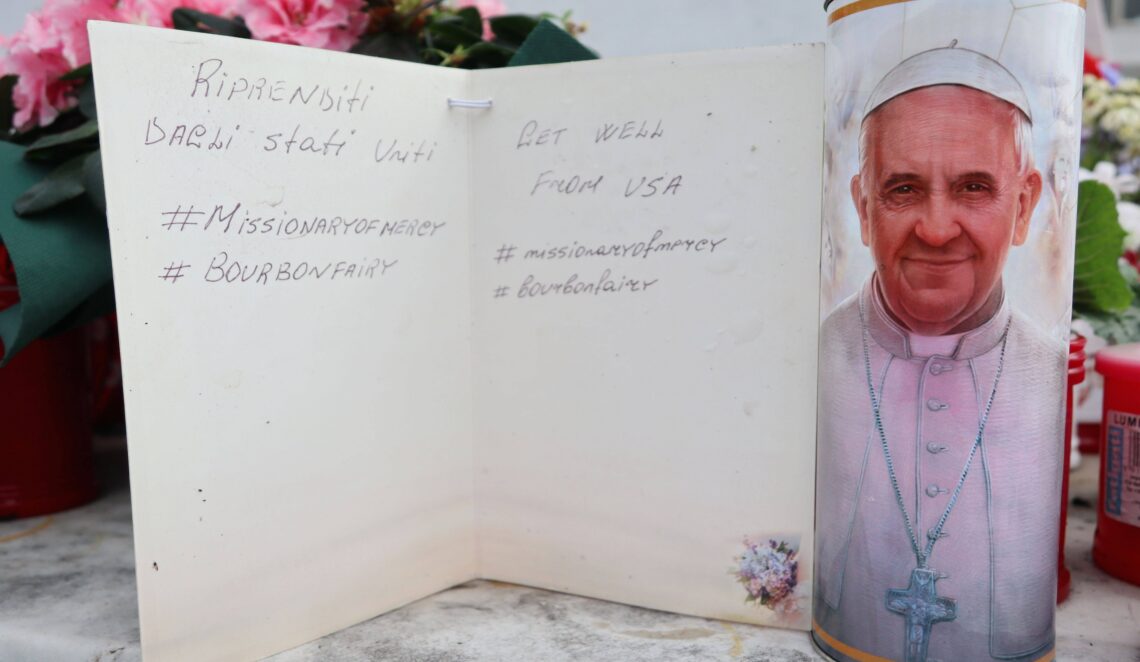Mädchen und Frauen leiden unter Krisen besonders schlimm
Dürren, Überschwemmungen, Kriege und Seuchen – wenn eine Krise kommt, leiden alle Menschen. Aber oft haben Mädchen und Frauen größere Probleme als Buben und Männer. Warum das so ist.

Durch den Klimawandel gibt es immer mehr Dürren, Überschwemmungen und Stürme. Besonders in ärmeren Ländern haben die Menschen dann oft nicht genug zu essen. Viele arbeiten in der Landwirtschaft, doch wenn die Ernte ausfällt, wird es schwer.
Frauen und Mädchen arbeiten in vielen Ländern auf den Feldern, aber oft gehört ihnen das Land nicht. Sie haben keine Maschinen oder Ersparnisse, um sich selbst zu helfen. Wenn eine Katastrophe passiert, sind sie oft besonders arm.
Hausarbeit statt Schule
In manchen Ländern haben viele Dörfer keine Wasserleitung. Vor allem nach einer längeren Dürre müssen Mädchen jeden Tag weit zu Fuß gehen, um Wasser zu holen. Dadurch bleibt keine Zeit mehr für die Schule.
Wenn Familien wenig Geld haben, muss genau überlegt werden, welches Kind zur Schule gehen kann. In vielen Ländern dürfen Buben eher weiterlernen als Mädchen. Mädchen müssen stattdessen arbeiten oder im Haushalt helfen.
Während der Coronapandemie (von Anfang 2020 bis Ende 2022) war das besonders schlimm. Viele Schulen waren geschlossen, und Mädchen konnten oft nicht am Onlineunterricht teilnehmen, weil sie sich um ihre Geschwister kümmern mussten. Millionen Mädchen haben dadurch ihre Schulbildung verloren.
Heiraten statt Kindheit
Wenn eine Familie sehr arm ist, kann es passieren, dass sie ihre Tochter früher verheiraten. Das zeigt eine Untersuchung der Hilfsorganisation Unicef in Bangladesch (ein Land in Südasien) und Äthiopien (ein Land im Osten Afrikas). Nach Überschwemmungen oder Dürren wurden in diesen Ländern mehr Mädchen gegen Geld oder Tiere verheiratet. Das bedeutet für diese Mädchen: keine Kindheit, keine Schule, keine Ausbildung.
Kein Schutz und kein Geld
Forschende schätzen, dass bis 2050 etwa 143 Millionen Menschen wegen Klimakatastrophen ihre Heimat verlassen müssen. Das sind etwa so viele Menschen, wie in ganz Russland leben. Mehr als die Hälfte dieser Flüchtlinge, also mehr als 72 Millionen, werden laut Schätzungen Frauen sein. Aber auch Buben und Männer sind betroffen – zum Beispiel, weil sie schwere Arbeiten erledigen oder in gefährliche Gebiete ziehen müssen, um Arbeit zu finden.
Frauen sind auf der Flucht oft besonders schutzlos. Sie reisen mit kleinen Kindern, haben wenig Geld und werden häufiger angegriffen. Aber auch Männer haben es schwer: Viele müssen gefährliche Wege gehen oder riskante Jobs annehmen.
Gleiche Chancen
Krisen sind für alle Menschen schwer. Männer müssen oft gefährliche Arbeit machen oder kämpfen. Frauen und Mädchen sind aber öfter von Armut betroffen. Sie haben weniger Chancen, die Schule zu besuchen und in vielen Ländern haben sie auch weniger Rechte als Männer. Deshalb ist es wichtig, dass alle Kinder – egal, ob Bub oder Mädchen – die gleichen Chancen bekommen!
Um gleiche Chancen für Mädchen und Frauen zu erhalten, gibt es den Weltfrauentag. Hier kannst du die Geschichte dieses Tages nachlesen.