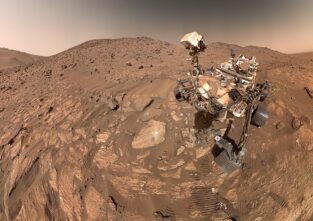EU-Staaten stimmen für Handel mit Südamerika
Die EU hat am Freitag einen wichtigen Schritt für ein wichtiges Abkommen mit vier Ländern in Südamerika gemacht. Doch viele Menschen in Österreich finden das nicht gut.

Über 25 Jahre wurde verhandelt. Jetzt ist ein großer Schritt geschafft. Die Europäische Union (EU) und Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay wollen künftig mehr Handel miteinander treiben. Dafür soll das sogenannte Mercosur-Abkommen sorgen.
Am Freitag stimmte eine Mehrheit der 27 EU-Länder dafür, dass der Pakt weitergehen kann.
Was bedeutet das?
Künftig können Firmen aus Europa ihre Waren leichter nach Südamerika verkaufen. Und umgekehrt. Firmen aus Südamerika können ihre Produkte leichter in EU Ländern verkaufen.
Was ist Mercosur überhaupt?
Mercosur heißt übersetzt ungefähr „Gemeinsamer Markt des Südens”. Gemeint ist ein Zusammenschluss von Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Diese Länder handeln schon seit über 30 Jahren viel miteinander.
Auch Bolivien gehört zu Mercosur, muss aber noch Regeln nachholen, deshalb ist dieses Land beim EU Abkommen noch nicht automatisch dabei.
Warum braucht es dafür einen eigenen Vertrag?
Ohne so einen Vertrag verlangen Länder beim Handel mit Firmen aus anderen Ländern oft Zölle. Zölle sind Extra-Gebühren. Das heißt: Firmen müssen diese Gebühren zahlen, wenn sie Waren in ein anderes Land verkaufen wollen.
Zum Beispiel: Wenn eine Firma aus Europa Maschinen nach Brasilien verkauft, können dafür etwa 20 Prozent Zoll fällig werden. Bei Autos kann es sogar 35 Prozent sein. Das macht die Produkte teurer. Dann kaufen weniger Menschen sie.
Mit dem Mercosur-Abkommen sollen viele dieser Zölle stark sinken oder sogar ganz wegfallen. Damit wird der Handel einfacher und oft auch billiger.
Was hat die EU davon?
In den vier Mercosur Ländern leben ungefähr 270 Millionen Menschen. In der EU leben etwa 450 Millionen Menschen. Zusammen wäre das ein riesiger Handels-Raum mit über 700 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern.
Für Firmen heißt das. Es gibt also sehr viele mögliche Kundinnen und Kunden in beide Richtungen. Außerdem will die EU beim Handel nicht nur von den USA und China abhängig sein.
Sind alle Länder der EU für dieses Abkommen?
Nein, nicht alle EU Länder finden dieses Abkommen gut. Österreich, Frankreich, Polen und Irland sind gegen das Mercosur-Abkommen. Vor allem viele Bäuerinnen und Bauern in diesen Ländern protestieren dagegen.
Sie fürchten, dass billigeres Fleisch aus Südamerika ihre Produkte verdrängt. In Südamerika verdienen die Menschen viel weniger als bei uns. Und beim Halten von Tieren und beim Schutz der Umwelt sind die Regeln oft auch nicht so streng wie in Europa. Dadurch können manche Waren billiger produziert werden.
Leute, die sich für den Umweltschutz einsetzen, warnen außerdem, dass durch mehr Handel auch mehr Regenwald im Amazonas abgeholzt werden könnte.
Warum kommt das Abkommen jetzt trotzdem?
Weil die Mehrheit der EU Länder für das Abkommen gestimmt hat. Aber bevor alles endgültig gilt, muss noch das Europäische Parlament zustimmen. Die EU-Kommission muss den Vertrag auch noch offiziell unterschreiben.