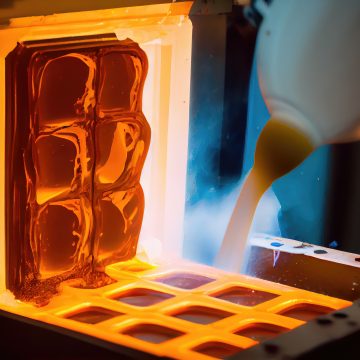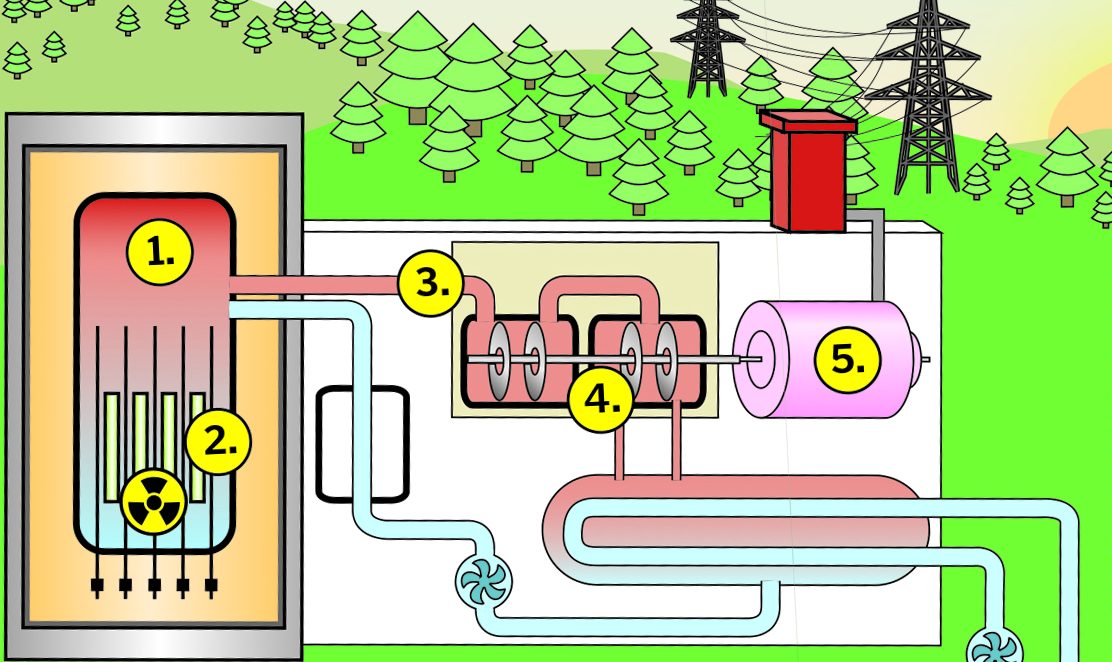Hitzerekorde: Dieser Sommer könnte heiß werden
Das Wasser der Weltmeere ist in diesem Jahr wärmer als sonst zu dieser Jahreszeit. Was das für das Wetter im Sommer bedeuten könnte.

Endlich zeigt sich der Sommer von seiner heißen Seite. Die letzten Tage mit Temperaturen von über 30 Grad Celsius in vielen Orten Österreichs haben uns vergessen lassen, dass der Start in diese Jahreszeit kalt und verregnet war. Doch während wir erst jetzt ins Schwitzen kommen, leiden viele Menschen in anderen Ländern heuer schon länger unter Hitzewellen.
Auch das Wasser der Weltmeere ist inzwischen wärmer als sonst zu dieser Jahreszeit. Für Wetterexperten ist das ein Zeichen dafür, dass dieser Sommer besonders heiß werden könnte. Denn die Wassertemperatur beeinflusst auch die Lufttemperatur an Land. Warmes Meerwasser kann auch für starke Regenfälle sorgen, denn es verdunstet schneller. Dieser Wasserdampf steigt in die Luft auf, trifft dort auf kältere Luftschichten und verwandelt sich in kleine Wassertropfen. Dadurch kommt es zu heftigen Regenfällen, das wiederum führt zu Überschwemmungen.
Hitzerekorde im Ozean
Jetzt könnte El Niño hinzukommen. El Niño ist ein sogenanntes Wetterphänomen, das alle zwei bis sieben Jahre im tropischen Pazifik auftritt. Das ist der Ozean zwischen Südamerika und der Ostküste Asiens. Dieses Wetterphänomen beeinflusst die Luftströmungen über dem Pazifik und die Temperaturen an der Meeresoberfläche. El Niño kann sich auf das Wetter in Amerika, Asien, Afrika und sogar Europa auswirken. (Mehr über El Nino erfährst du hier.)
Das warme Meerwasser hat aber auch Auswirkungen auf das Leben der Meerestiere. Denn in warmem Wasser gibt es weniger Nährstoffe und weniger Sauerstoff. Fischschwärme ziehen in kältere Gebiete, wo sie mehr Nahrung finden. Für die Menschen, die vom Fischfang leben, ist das eine Katastrophe, denn ohne Fische haben sie auch kein Einkommen.
Ob es in diesem Jahr aber tatsächlich einen besonders heißen Sommer mit mehreren Hitzewellen geben wird, können die Wetterexperten nicht vorhersagen.