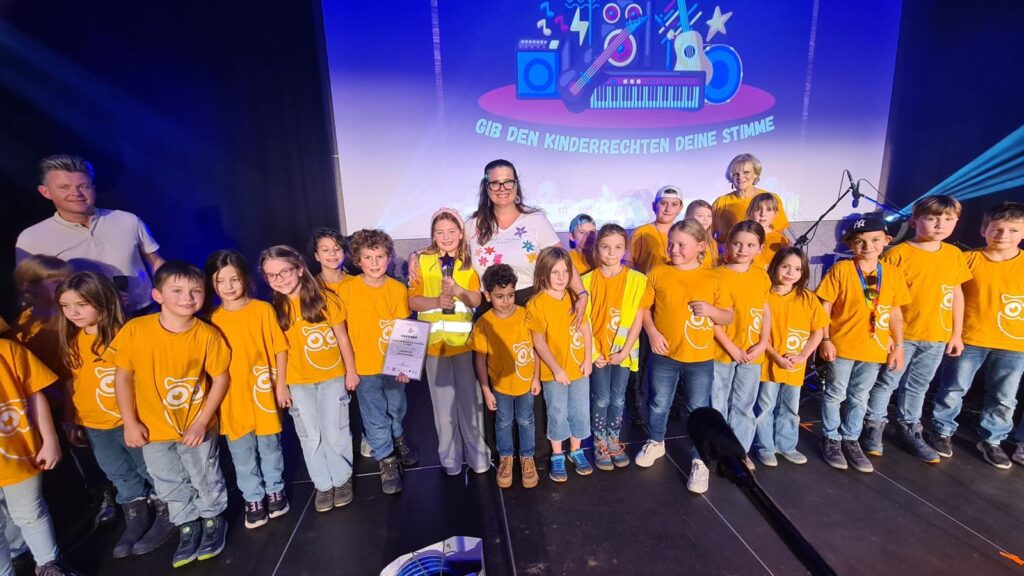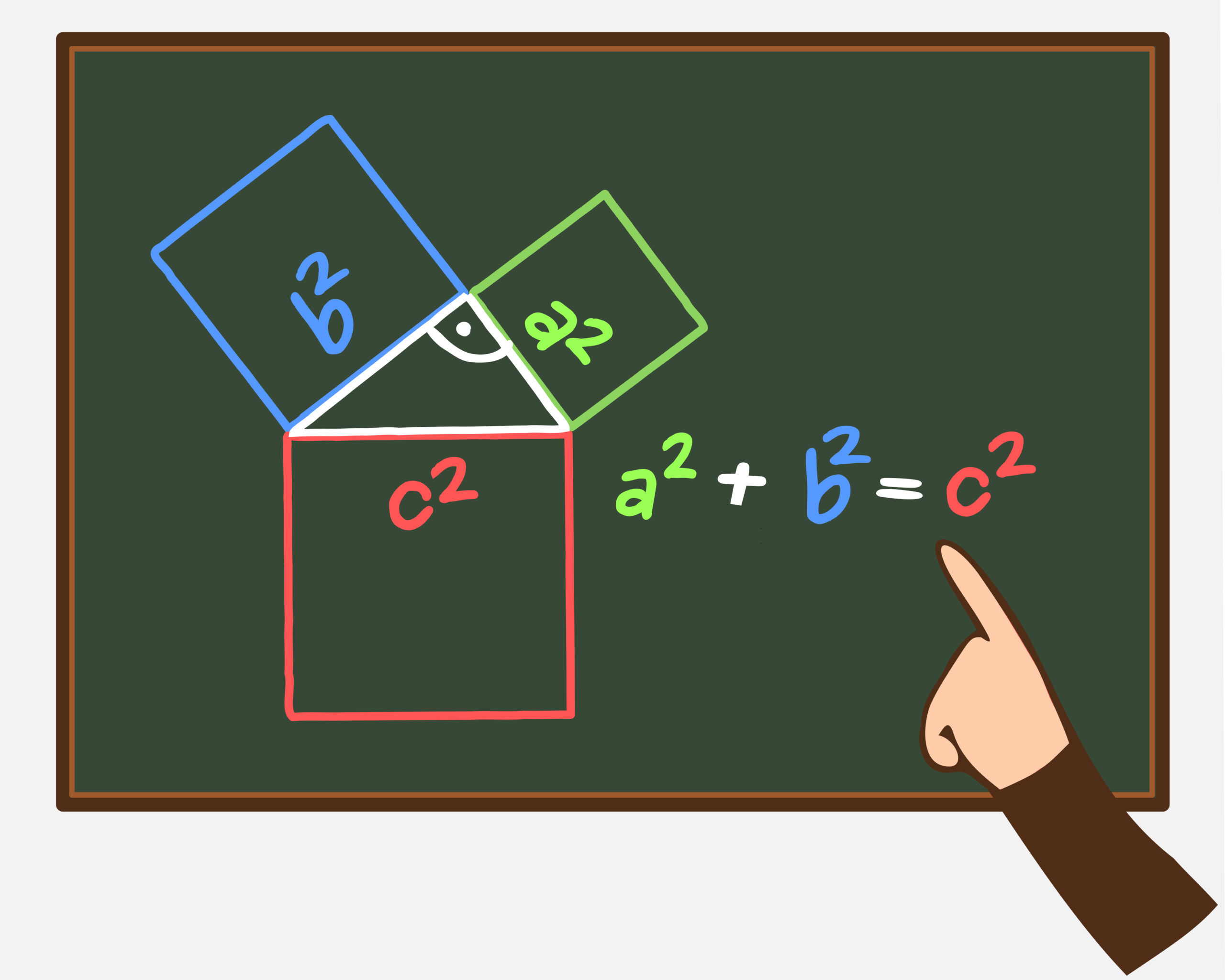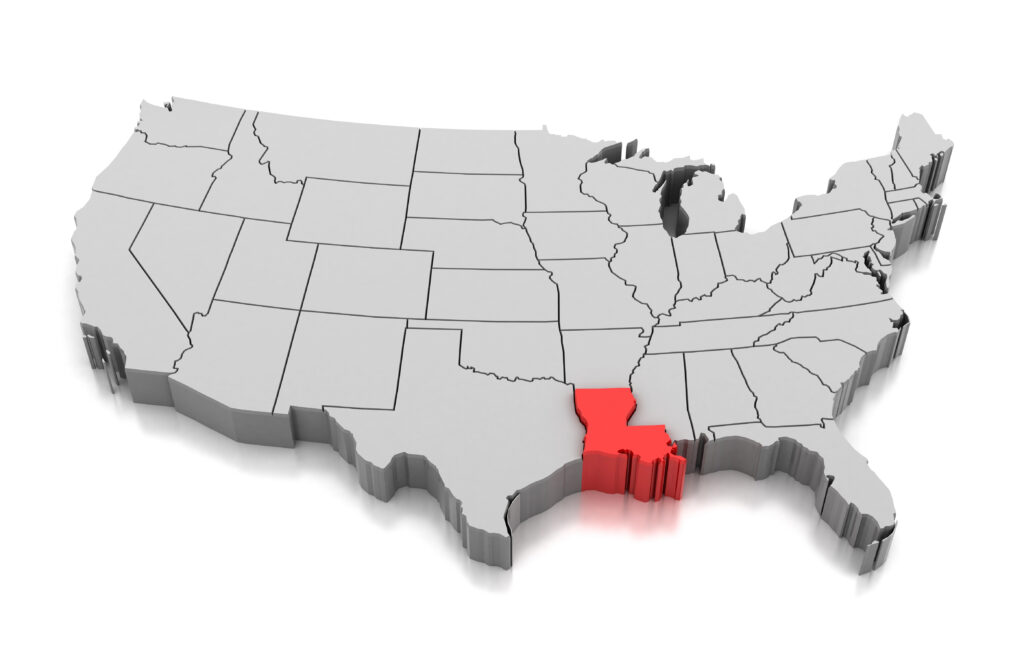Muscheln gegen den steigenden Meeresspiegel
Eine Muschelart in der Nordsee bringt Wissenschaftler zum Nachdenken. Mit der Hilfe dieser Muscheln könnte es gelingen, die Küste vor dem Anstieg des Meeresspiegels zu retten.

Muscheln müssen so Einiges aushalten. Hohe Wellen, raue Felsen, alles nicht unbedingt gemütlich. Aber genau jene Eigenschaften, die Muscheln trotzdem auf Steinen und Felsen wachsen lassen, interessiert aktuell eine Forschergruppe an der Nordsee. Dieses Meer liegt im Nordwesten Europas zwischen Großbritannien, Dänemark und Norwegen. An der Nordsee kommt es immer wieder zu Sturmfluten. Starker Wind treibt das Wasser vom Meer in Richtung Küste. Und das richtet großen Schaden an. Das salzige Meerwasser ist nämlich nicht gut für Felder, Wiesen und Pflanzen. Auch Überschwemmungen gibt es dort häufig, die Häuser und Straßen beschädigen. Wie soll gegen diese Urgewalt des Meeres eine kleine Muschel ankommen?
Muscheln als natürliche Helfer
Die Muscheln, um die es geht, sind pazifische Austern. Diese Muschelart ist besonders, weil sie ziemlich schnell wächst. Abhängig von Wetter und der Zahl der Austern kann ein Riff bis zu zwei Zentimeter pro Jahr wachsen. Das ist für Muscheln echt viel. Dazu kommt, dass die Austern viel aushalten und sich von hohen Wellen nicht beeindrucken lassen. Deshalb überlegt man, sie als natürliche Wellenbrecher einzusetzen. Eigentlich sind das Bauwerke, die das Ufer vor Hochwasser und Überschwemmungen schützen sollen. Wellenbrecher aus der Natur wären aber eine noch bessere Lösung. Man müsste dann nämlich weniger in das Ökosystem eingreifen.

Glück gehabt
Ursprünglich sind die Austern in der Nordsee gar nicht vorgekommen. Mitte des 20. Jahrhunderts sind einige Austern dort „ausgesetzt“ worden, weil man wissen wollte, ob sie dort wachsen. Das haben sie getan. Sehr gut sogar. Die Austern haben sich rasend schnell verbreitet und dabei auch heimische Muschelarten wie die Miesmuscheln verdrängt. Fast alle Bereiche, in denen es früher Miesmuscheln gegeben hat, sind heute von Austern bedeckt.
Die Forscher sagen auch, dass die Auster eins ganz deutlich zeigt: Man muss aufpassen, wenn man eine nicht-heimische Art in ein Ökosystem lässt. Das kann große Auswirkungen auf die Natur haben. Mittlerweile hat sich dieser Bereich der Nordsee an die Austern gewöhnt und viele Fischarten bewohnen die Riffe. Und die Miesmuscheln sind zum Glück doch nicht ganz verschwunden. Sie wachsen nämlich auch auf den Austernriffen.
Die Austern sollen die Küste auch vor hohen Wellen schützen. Falls du schon immer wissen wolltest, wie Wellen überhaupt entstehen, ist dieser Artikel etwas für dich.