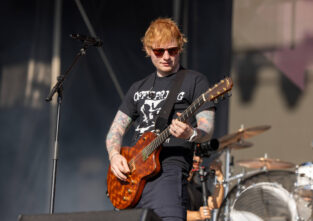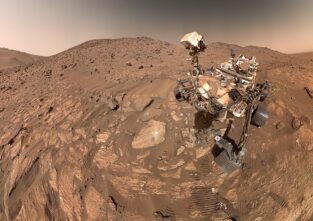Verkehr: Auf der sicheren Seite
Verkehr: Das erste Mal allein zur Schule – was für ein Abenteuer! Ein Experte gibt Tipps, wie du sicher im Klassenzimmer ankommst.

Welche Stellen eignen sich am besten, um die Straße zu überqueren?
Grundsätzlich gilt: Halte immer nach einem Zebrastreifen Ausschau. Ist kein Sicherheitsweg vorhanden, suche am besten nach einer geraden, übersichtlichen Straßenstelle. Du bist dir unsicher? Lass dir von einem Erwachsenen mögliche Gefahren auf deinem Schulweg zeigen. Du könntest zum Beispiel regelmäßig mit deinen Eltern oder mit Oma und Opa den Weg abgehen, bis du über alles Bescheid weißt. Auch wenn du dich gut auskennst, solltest du nicht damit anfangen, deinen Schulweg einfach abzukürzen. Der kürzeste Weg ist nämlich nicht immer der beste und birgt manchmal Gefahren.
Warum muss ich auf der Straße links, rechts, links schauen?
Das hat vor allem einen Grund: In Österreich herrscht sogenannter Rechtsverkehr. Das heißt, dass die Fahrzeuge am rechten Straßenrand fahren. Wenn du nach links siehst, kommen die Autos auf der Seite angefahren, die dir am nächsten ist. Blickst du nach rechts, siehst du, ob die andere Straßenseite frei ist. Bevor du losgehst, blickst du trotzdem noch einmal nach links. Schließlich könnte sich in der Zwischenzeit ein Fahrzeug genähert haben. Doch wo ist rechts und wo ist links? Ganz einfach: Streck beide Hände aus und bilde mit Daumen und Zeigefinger ein „U“. Die linke Hand formt ein „L“ während die rechte Hand den Buchstabenspiegel verkehrt zeigt.
Ich bin in Eile und habe keine Zeit. Muss ich trotzdem links, rechts, links schauen?
Ja, immer! Sogar bei Ampeln, Schranken, Gleisen, Schienen, Radwegen und Zebrastreifen. Technische Geräte wie Ampeln könnten zum Beispiel kaputt sein. Oder Autofahrer werden durch die Sonne geblendet und sind abgelenkt. Deshalb gilt: Immer auf Nummer sicher gehen!
Verkehr, Internet, Selbstverteidigung: Alles rund ums Thema Sicherheit
Sich wohlfühlen und ohne Angst vor Gefahren durch das Leben zu gehen, ist wichtig. Dieser Beitrag zum Thema Sicherheit ist Teil einer Serie, die im vergangenen Jahr in der der Printausgabe der Pausenzeitung erschienen ist. Bei Selbstschutzexperte und Autor Markus Schimpl lernst du die Fähigkeiten deines Körpers kennen und erfährst, dass du etwas tun kannst, wenn Gefahr droht. Außerdem geht es darum, Gefahr zu verhindern, bevor sie überhaupt entsteht. Das wird auch Prävention genannt. Aber was ist das? Hier ein Beispiel: Du siehst eine rutschige Stelle am Boden. Was tust du? Die rutschige Stelle meiden oder langsam drübergehen? Die Antwort: Um dich gar nicht erst in Gefahr zu begeben, wirst du die rutschige Stelle umgehen. Und genau das ist Prävention.

Buchtipp: Markus Schimpl. Ich rette mich. 208 Seiten, 20 Euro. Markus Schimpl ist Selbstschutzexperte und Autor. Außerdem unterrichtet er Selbstschutz an Schulen. Mehr Infos unter: www.ichrettemich.com